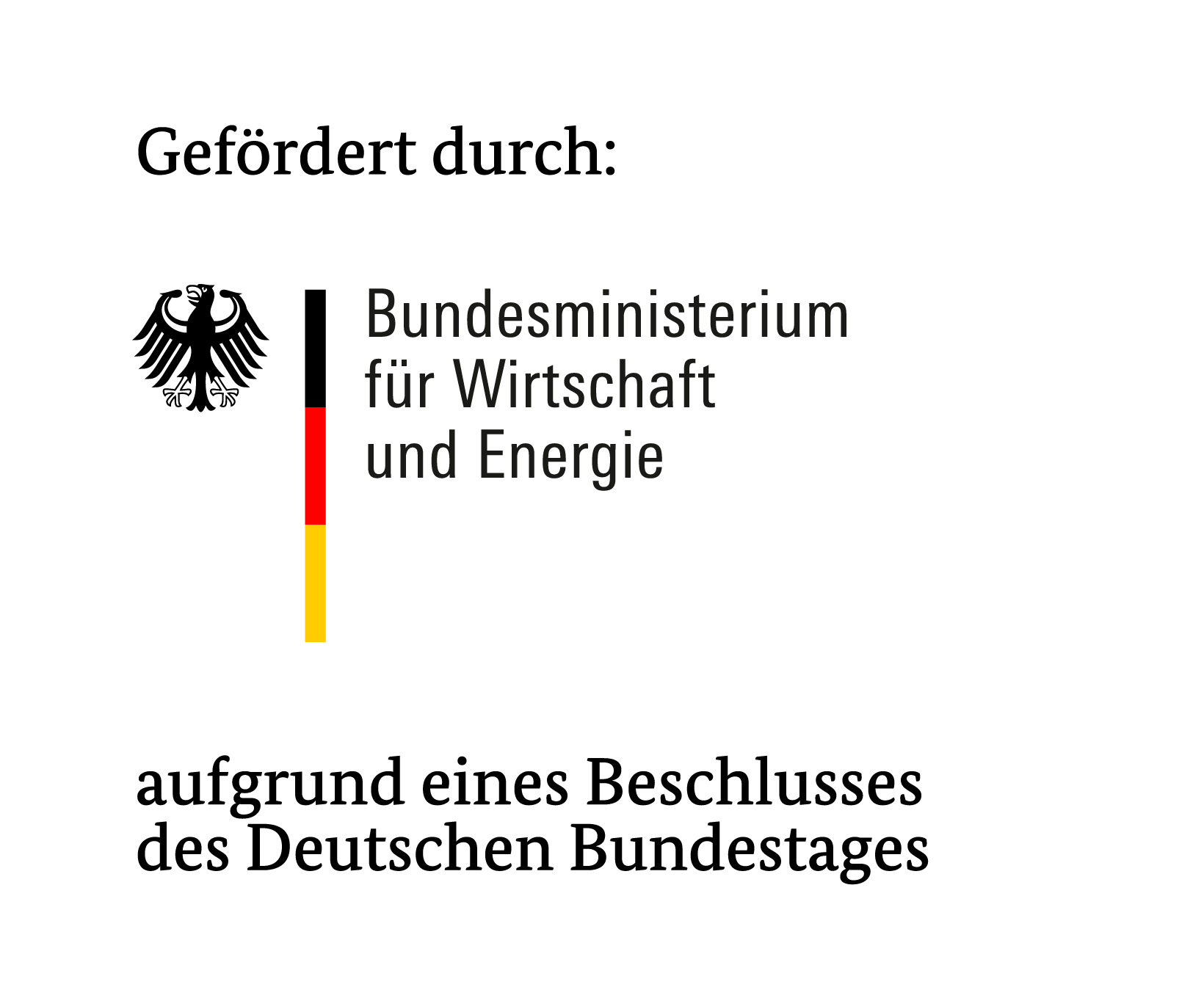Merit Order der Energiespeicherung im Jahr 2030 (MOS 2030)

Entwicklung und Darstellung kostenoptimierter Speicherinfrastrukturen in Form von Merit Order Kurven
Motivation und Zielsetzung
Der Aufbau einer wirtschaftlichen Versorgungsinfrastruktur zur Integration eines hohen Anteils fluktuierender regenerativer Stromerzeugung wirft aufgrund weltweit fehlender Erfahrung viele Fragen auf. Zwei der Kernfragen sind dabei:
1. Welche Systeminfrastruktur ist unter gegebenen Rahmenbedingungen aus Kostensicht am günstigsten für das Versorgungssystem?
2. Welche Fördermechanismen müssen entwickelt werden, damit sich eine zu favorisierende Systeminfrastruktur auch am Markt durchsetzen kann?
Unter Merit Order wird in der Studie eine relative Einordnung verschiedener Speichertechnologien hinsichtlich ihres Mehrwerts beim langfristigen Ausbau von Speichern verstanden, jeweils aus System- und Akteurssicht. Abbildung 1 gibt einen schematischen Überblick zum geplanten Vorgehen.

Einzelmaßnahmen
In der Kraftwerks-, Netz- und Pumpspeichertechnik kann auf langjährige Erfahrungswerte bei Auslegung und Betrieb zurückgegriffen werden. Neuere Ansätze zur Flexibilisierung der Last und Erzeugung durch direkte oder indirekte Speicherung sind hingegen kaum erforscht. Dies gilt insbesondere in der großtechnischen Anwendung. Für einen umfassenden Vergleich der Potenziale verschiedener Flexibilisierungsoptionen ist es von Vorteil, eine einheitliche Grundlage für die Potenzialabschätzung nutzen zu können. In diesem Forschungsvorhaben werden in einzelnen Praxisprojekten unter Industriebeteiligung die Lastverschiebungspotenziale verschiedener Flexibilisierungsoptionen erhoben.
Gesamtsystem
Aus Gesamtsystemperspektive sollen rechtliche und regulatorische Stellschrauben identifiziert werden, durch die sich der betriebswirtschaftlich einstellende Speicherausbau möglichst mit einem volkswirtschaftlich zu favorisierenden Ausbau in Übereinstimmung bringen lässt. Dies lässt sich mit dem Bild einer Waage sehr gut veranschaulichen, wie folgende Abbildung zeigt:

Dafür soll eine regionale Betrachtung der Speicherpotenziale unter Berücksichtigung der Stromnetze durchgeführt werden. Hierfür wird das Regionenmodell der FfE um eine Abbildung des Netzes und eine verbesserte räumliche Auflösung von Erzeugern und Verbrauchern zum Teil auch auf europäischer Ebene erweitert. Zusammen mit historischen und prognostizierten Daten zu den Erlös- und Kostensenkungspotenzialen soll dann eine Bewertung der Technologien vorgenommen werden. Für die Prognosen soll ein lineares Optimierungsmodell entwickelt werden. Hieraus ist das Modell ISAaR entstanden. Durch Szenarioberechnungen mit neuen Marktmechanismen und angepassten politischen Rahmenbedingungen sollen Maßnahmen herausgearbeitet werden, die eine volkswirtschaftlich sinnvolle Lösung fördern.
Am Ende des Projektes zeigte sich, dass eine hierzu gute Übersicht der betroffenen Technologien gewonnen werden kann, wenn diese in Form der Merit Order Matrix mit den beiden Achsen Rentabilität aus Akteurssicht bzw. Systemsicht dargestellt werden. Die Akteurssicht stellt dabei die betriebswirtschaftliche Sichtweise und die Systemsicht die volkswirtschaftliche dar.

Das Forschungsprojekt hat am 1. September 2012 begonnen und wurde Anfang 2016 abgeschlossen. Die Abschlussberichte zum Projekt stehen nun zum Download bereit:
Veröffentlichungen und Vorträge
- Flexbook – technische und wirtschaftliche Analyse von Flexibilitätstechnologien
- Modellierung des Übertragungsnetzes im Zuge von MONA 2030
Vortrag auf dem International Symposium on Energy System Optimization ISESO 2015 am 17.11.2015 - Modellierung der flexiblen Energiebereitstellung von Wasserkraftwerken in Europa
9. Internationale Energiewirtschaftstagung (IEWT) an der TU Wien, 11. Februar 2015 - Power2Gas – Hype oder Schlüssel zur Energiewende?
Veröffentlichung in der et, Ausgabe 10, Oktober 2014 - Flexibilisierung des Versorgungssystems: Kraftwerke – Netze – Speicher – Verbraucher
15. Berliner Energietage, 19.-21. Mai 2014 - Modell zur Erstellung anlagenscharfer Ausbauszenarien für Windkraftanlagen
45. Kraftwerkstechnisches Kolloquium der TU Dresden, 15.-16. Oktober 2013 - Möglichkeiten und Grenzen des europäischen Verbundsystems
45. Kraftwerkstechnisches Kolloquium der TU Dresden, 15.-16. Oktober 2013 - Challenges for Future Price Modelling
European Forum on Electricity Pricing, 27-28 May 2013, Berlin, Germany - Regionales Speicherpotenzial im Übertragungsnetz
8. Internationale Energiewirtschaftstagung (IEWT) an der TU Wien, 15. Februar 2013 - Merit-Order-Matrix der Speicheroptionen
8. Internationale Energiewirtschaftstagung (IEWT) an der TU Wien, 13. Februar 2013 - Erneuerbare Energien in Sachsen
10. Sächsisches GIS-Forum, Dresden, 30. Januar 2013 - The Impact of Technological Megatrends on Future Electricity Prices
3. European Electricity Price Modelling & Forecasting Forum, Berlin, 26.-28. November 2012 - Lastganganalyse zur Bestimmung der Wechselwirkungen ausgewählter Speichersysteme
44. Kraftwerkstechnisches Kolloquium der TU Dresden, 23.-24. Oktober 2012
Pressemeldungen
- Deutschland steigert Stromexportüberschüsse um 50 % in 2013
Veröffentlicht am 17. Januar 2014 - Energiepolitik im neuen Koalitionsvertrag: Power2Heat als ein zentrales Element im Wärmemarkt
Veröffentlicht am 29. November 2013 - Erhebliche regionale, saisonale und tageszeitliche Unterschiede bei den Stromexporten im Jahr 2012
Veröffentlicht am 17. April 2013
Forschungsverbund Systemanalyse Energiespeicher
Im Rahmen des Projekts ist die FfE in dem aufgrund einer Initiative des Projektträgers Jülich gegründeten Forschungsverbund „Systemanalyse Energiespeicher“ vertreten. Dem Forschungsverbund gehören weiterhin das Bremer Energieinstitut (BEI), der Lehrstuhl für Energiewirtschaft der Universität Duisburg-Essen (EWL) sowie das Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung der Universität Stuttgart (IER) an.
Förderung und Projektpartner
Diese Studie wird im Rahmen der Forschungsinitiative Energiespeicher durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) gefördert (Förderkennzeichen: 03ESP110A).
Neben dem BMWi unterstützen auch 13 Industriepartner aus den Bereichen Energieversorgung, Übertragungsnetze und Automobilproduktion das Forschungsvorhaben.