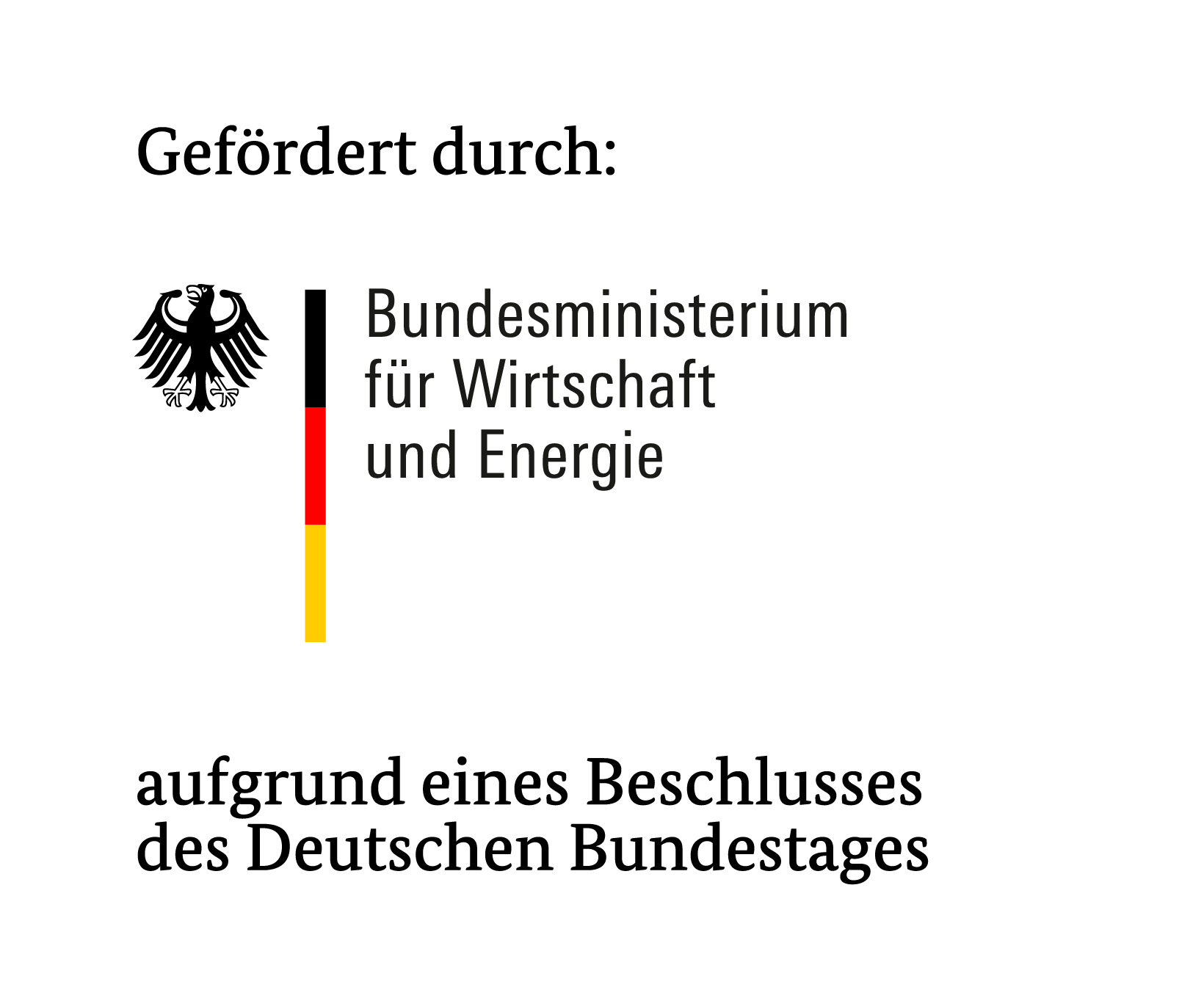Das Kopernikus-Projekt SynErgie

Mit den Kopernikus-Projekten startete das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Jahr 2016 die bisher größte Forschungsinitiative zur Energiewende. Innerhalb einer Laufzeit von zehn Jahren werden technologische und wirtschaftliche Lösungen in den vier Schlüsselbereichen neue Netzstrukturen, Power-to-X, Industrieprozesse und Systemintegration entwickelt. Insgesamt stehen hierfür 400 Mio. Euro bereit.
Die FfE beschäftigt sich im Projekt SynErgie mit der Flexibilisierung von Industrieprozessen. Das Projekt hat zum Ziel in Einklang mit rechtlichen und sozialen Aspekten, alle technischen und marktseitigen Voraussetzungen zu schaffen, um den Energiebedarf der deutschen Industrie maßgeblich mit dem volatilen Energieangebot zu synchronisieren.
SynErgie trägt damit zur gesellschaftlich akzeptierten sowie kosteneffizienten Realisierung der Energiewende auf Basis Erneuerbarer Energien bei. Die erzielten Erkenntnisse bilden zudem die Grundlage für Deutschland, sich zum internationalen Leitanbieter für flexible Industrieprozesse und Technologien zu entwickeln.

Die Themenfelder des Projektes SynErgie sind:
- Industriebranchen – Schlüsselproduktionsprozesse
- Produktionsinfrastruktur
- Informations- und Kommunkationstechnologie (IKT)
- Markt- und Stromsystem
- Potenzialanalyse und systemische Betrachtung
- Energieflexible Modellregion
Start in die dritte Phase des Kopernikus-Projektes SynErgie
In Zusammenarbeit mit weiteren Forschungsinstituten und Branchenvertretern wird die FfE bis Juli 2026 folgende Themengebiete bearbeiten:

Für die Industriequartiere und Sektorkopplung ist die FfE im Arbeitspaket „Energieflexibilität im Stadtbach-Industriequartier“ tätig. Dabei wird in der Modellregion Augsburg das energie- und CO2-intensive Industriequartier hinsichtlich seiner energetischen, wirtschaftlichen und klimabezogenen Potenziale zur Umsetzung der Transformation vorbereitet. Im Mittelpunkt des Industriequartiers steht die Fragestellung, wie eine klimaneutrale Wärmebereitstellung durch unterschiedliche Energieträger konzipiert und im Hinblick auf die aktuell herrschenden und künftig möglichen regulatorischen Rahmenbedingungen wirtschaftlich erreicht werden kann. Die FfE konzentriert sich dabei auf die Evaluation der Gesamtwärmeplanung, einschließlich des Abgleichs, der Validierung und Bewertung der abgeleiteten Energieflexibilität der kommunalen Wärmeplanung und des Industriequartiers Stadtbach. Ziel der „Energieflexibilisierung durch bidirektionales Lademanagement“ ist es, ein bidirektionales E-Flottenlademanagement zur Energieflexibilitätsbereitstellung zu entwickeln und zu implementieren. Die FfE begleitet die Realisierung des flexiblen Lademanagements simulativ und untersucht die ökonomischen und ökologischen Potenziale.
Im Rahmen der Potenzialanalyse werden in SynErgie 3 folgende Arbeitsgebiete untersucht:
- In der Internationale Marktanalyse und Geschäftsmodellentwicklung für Exporttechnologien untersucht die FfE mit Hilfe der Partner die Bedeutung von Energieflexibilität im internationalen Kontext. Der Erkenntnisgewinn soll dazu dienen einen Leitfaden zu entwickeln, der mögliche Realisierungen von Energieflexibilitätserbringung in anderen Ländern quantifiziert (Markanalyse, Geschäftsmodelle).
- Für die Kontinuierliche Abfrage und Aggregation der praktischen Energieflexibilitätspotenziale werden die aus der ersten und zweiten Projektphase umfangreich erhobenen Flexibilitätspotenziale und -perspektiven verschiedener Industriebranchen zum einen regelmäßig aktualisiert, und zum anderen durch die Analyse weiterer Prozesse ergänzt. Dies ermöglicht, die Quantifizierung des industriellen Flexibilitätspotenzials in Deutschland weiter zu verfeinern.
- Ziel des Arbeitspaketes Industrietransformation und Wechselwirkungen mit der industriellen Energieflexibilität ist die Untersuchung branchenspezifischer Transformationspläne und der zukünftigen Rolle von Wasserstoff in der Industrie. Zusätzlich erfolgt eine Analyse der Auswirkungen dieser Erkenntnisse auf Energieflexibilitätspotentiale.
In der energieflexiblen Modellregion Augsburg führt die FfE eine praxisorientierte Energieflexibilitätsanalyse leitungsgebundener Fernwärmeversorgungsanlagen im Zusammenspiel mit gewerblicher Abwärmenutzung durch. Beiträge zur Flexibilisierung der Energienachfrage sind die Entwicklung von Flexibilitätsvermarktungsstrategien sowie die Erarbeitung von Handlungsempfehlungen zur Übertragbarkeit dieser Strategien auf andere Regionen in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Augsburg.
In der Weiterentwicklung Regulierung erarbeitet und erprobt die FfE eine Methode zur Ableitung von Empfehlungen für die Erweiterung der Energiemanagementnorm DIN EN ISO 50001 um das Themas Energieflexibilität. Aktuell fordert die Energiemanagementnorm von zertifizierten Unternehmen eine fortlaufende Verbesserung der leistungsbezogenen Energiekennzahlen, was im Widerspruch zu einer energieflexiblen Fahrweise stehen kann. Ziel ist ein White Paper mit Handlungsempfehlungen zur Erweiterung der DIN 50001 um das Themenfeld Energieflexibilität zu entwickeln.
Blick in Ergebnisse der FfE aus der zweiten Förderphase des Kopernikus-Projektes SynErgie

Zur Erweiterung des Buches aus der ersten Förderphase wurde ein zweiter Band mit dem Titel „Markt- und Stromsystem, Managementsysteme und Technologien energieflexibler Fabriken“ veröffentlicht, um die Ergebnisse zusammenzufassen. Für die FfE lag in der zweiten Projektphase erneut der Fokus auf der Analyse der Energieflexibilitätspotenziale (EFP) und deren Auswirkungen auf das Energiesystem. Zur Analyse und Identifikation von Flexibilitäten, wurde mit dem Energieflexibilitätsaudit ein Praxis-Tool entwickelt, womit Unternehmen ihre Energieflexibilitätsziele technisch wie wirtschaftlich verfolgen können. Dieses Audit wurde erfolgreich an zwei Standorten der Projektpartner Kärcher und Alois Müller umgesetzt, wodurch insgesamt 28 Energieflexibilitätsmaßnahmen (EFM) identifiziert und charakterisiert werden konnten.
Für die Aggregation der Energieflexibilitätspotenziale und -perspektiven der in SynErgie betrachteten Schlüsselproduktionsprozesse und Querschnittstechnologien resultiert im Fall einer Lasterhöhung und einer Abrufdauer von mindestens 15 Minuten ein EFP von 9,0 GW bzw. 46 TWh/a. Im Fall des Lastverzichts ergibt sich für die gleiche Abrufdauer ein EFP in Höhe von 10,7 GW bzw. 48 TWh/a. Die Daten werden in einer Energieflexibilitätsdatenbank nachgehalten. Diese wurde im Zuge der Vorbereitung für die dritte Förderphase überarbeitet. Die Methodik basiert auf den in der ersten Förderphase entwickelten Fragebögen.
Für die identifizierten EFM und deren EFP ergab sich bisher ein CO2-Vermeidungspotenzial von ca. 700.000 t CO2, welches durch eine Stromflexibilisierung in der Industrie erreicht werden könnte. Ausgewählte disruptive CO2-Verminderungsmaßnahmen in der Industrie ergeben ein zusätzliches positives bzw. negatives EFP von 7,7 GW bzw. 6,3 GW in 2050 gegenüber 2018. Die Energieflexibilität steigt im gleichen Zeitraum auf 10,8 TWh an. Die Kappung von CO2-Emissionsspitzen durch Lastverzicht stellt auch zukünftig ein hohes Potenzial zur Senkung der CO2-Emissionen dar, aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten weist jedoch der Einsatz von Lasterhöhung ein höheres Potenzial zur Kostenreduktion auf. Für einen netzdienlichen Einsatz ist die regionale Verteilung der EFP entscheidend. Besonders hohe EFP sind in den deutschen Industriezentren (Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz) erkennbar. Zur Einordnung von industriellen EFM gegenüber konkurrierenden Flexibilitätsoptionen wurde eine systemische Kosten-Nutzen-Abschätzung durchgeführt. Aus den Ergebnissen lassen sich Schlussfolgerungen auf attraktive Einsatzgebiete aus Systemsicht mit Implikationen auf künftige Schwerpunkte und regulatorische Rahmenbedingungen ziehen.
Erfolgreicher Abschluss der ersten Projektphase im Kopernikus-Projekt SynErgie

Im Rahmen der ersten Projektphase wurde das Buch „Energieflexibilität in der deutschen Industrie“ erarbeitet und beinhaltet zusammenfassend alle bis dato relevanten Ergebnisse und Erkenntnisse.
Für die FfE wurde 2019 die erste Projektphase erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen des Projektes SynErgie entwickelte die FfE in Zusammenarbeit mit weiteren Forschungsinstituten und Branchenvertretern eine Methodik zur Erhebung von Flexibilitätspotenzialen. Der Fokus lag zunächst auf folgenden Branchen der Grundstoffindustrie – Chemie, Feuerfest, Glas, Stahl und Zement. Gemeinsam mit Branchenvertretern wurden typische Prozesse der einzelnen Branchen identifiziert. Für Chlor-Alkali-Elektrolyse, Rohstoffschmelzanlage, Behälterglasherstellung, Elektrolichtbogenofen sowie Roh- und Zementmahlung wurden die Potenziale zur Lastflexibilisierung zunächst auf Prozessebene bestimmt.
Im Fokus stand dabei die Entwicklung eines Fragebogens zur Erhebung der Flexibilitätspotenziale und Identifikation bestehender Hemmnisse. Um die Hürden bei der Umsetzung näher zu analysieren, wurden zusätzlich vor-Ort-Termine bei Unternehmen durchgeführt.
Es zeigte sich, dass die Prozesse der Grundstoffindustrie aufgrund ihrer vergleichsweise hohen Anschlussleistungen prinzipiell gut für den Einsatz zur Lastflexibilisierung geeignet sind. Allerdings ist die Auslastung in diesen Branchen besonders hoch, d.h. die Produktion läuft, mit Ausnahme notwendiger Wartungsintervalle, nahezu das gesamte Jahr über durch. Daher bleibt für Flexibilität oft wenig Spielraum. Die besondere Herausforderung besteht darin, eine Reduktion der Produktion aufgrund einer zeitweiligen Lastreduktion wieder auszugleichen, um einen Produktionsausfall zu vermeiden. Zusätzlich schränkt die hohe Auslastung die Möglichkeiten zur Lasterhöhung ein, da die Anlagen meist bereits nahezu bei Volllast betrieben werden. Nichtsdestotrotz könnten die betrachteten Branchen zukünftig einen wichtigen Beitrag zur Flexibilität leisten.
Ein erster Schritt in diese Richtung wurde im Projektverlauf bereits durch die Untersuchung zukünftiger Potenziale durch technische Eingriffe bzw. Veränderungen an Prozessen – sogenannte Flexibilitätsperspektiven – unternommen. Hierzu zählen vorrangig die Hybridisierung und Elektrifizierung von Prozessen sowie weitere Maßnahmen, die einen flexibleren Betrieb der Anlagen ermöglichen.
Darüber hinaus beteiligte sich die FfE an der Entwicklung von Anforderungsprofilen. Diese beschreiben charakteristische energiewirtschaftliche Situationen für die Bereitstellung von Flexibilität:
Das Profil „Kurzfristige Anpassung der Last“ wurde in Anlehnung an die Minutenreserve definiert. Es beschreibt kurzfristige Lastreduktionen oder erhöhungen, welche zum Ausgleich kurzfristiger Schwankungen von Erzeugung und Verbrauch notwendig sind.
Das Profil „Anpassung der Last über mehrere Stunden“ umfasst Strompreisschwankungen aufgrund der fluktuierenden Einspeisung aus Photovoltaik und Windenergie im Tagesverlauf. Durch eine Anpassung des Verbrauchs, können so die Kosten für den Strombezug reduziert werden.
Die „Dunkelflaute“ erfordert eine Reduktion der Last über mehrere Tage. Im Winter können durch die schwächere Sonneneinstrahlung und mehrere aufeinanderfolgende windstille und bewölkte Tage sehr ungünstige Situationen für die Erzeugung aus Erneuerbaren Energien und damit extreme Preisspitzen auftreten. Durch eine Lastreduktion in diesem Zeitraum und den Wiederverkauf des bereits kontrahierten Strombezugs, können erhebliche Erlöse generiert werden.
Steckbriefe und exemplarische Auswertungen zu den Anforderungsprofilen finden Sie im Downloadbereich.
Förderung
Das Forschungsprojekt wird durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMBF) gefördert (Förderkennzeichen: 03SFK3E3-3 (e.V.) & 03SFK3O0-3 (GmbH)).
Studie „Flexibilitätsoptionen in der Grundstoffindustrie – Methodik, Potenziale, Hemmnisse“
In Zusammenarbeit mit weiteren Forschungsinstituten und Branchenvertretern hat die FfE eine umfassende Studie „Flexibilitätsoptionen in der Grundstoffindustrie – Methodik, Potenziale, Hemmnisse“ veröffentlicht. Diese steht hier zum Download zur Verfügung.
Studie „Flexibilitätsoptionen in der Grundstoffindustrie II – Analysen, Technologien, Beispiele“
In Zusammenarbeit mit weiteren Forschungsinstituten und Branchenvertretern hat die FfE eine umfassende Studie „Flexibilitätsoptionen in der Grundstoffindustrie II – Analysen, Technologien, Beispiele“ veröffentlicht. Diese steht hier zum Download zur Verfügung.
Weitere Informationen:
-
- So stark könnte die Industrie das deutsche Stromnetz entlasten
- The role of aggregators in facilitating industrial demand response: Evidence from Germany
- Zwischenbericht aus dem Kopernikus-Projekt SynErgie
- Pressemitteilung: Umfassende Studie „Flexibilitätsoptionen in der Grundstoffindustrie – Methodik, Potenziale, Hemmnisse“ erschienen
- Aggregatoren in Deutschland und deren Einschätzung der Anforderungsprofile
- Anforderungsprofile für den Einsatz von Lastflexibilisierung – Einschätzung der Aggregatoren und Erlösmöglichkeiten
- Die Gasversorgung im Wandel – Vor welche Herausforderungen Power-to-Gas die Industrie stellt
- Pressemittleitung: Studie „Flexibilitätsoptionen in der Grundstoffindustrie II – Analysen, Technologien, Beispiele“ erschienen
- Flexibilitätspotenzial industrieller Wärmenetze durch Hybridisierung
- Potenzialanalyse zur Hybridisierung von Prozessen in der Grundstoffindustrie
- Electrical flexibility potential of hybrid industrial heat networks in Germany